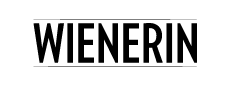Das Gehirn braucht mehr grünen Daumen
Lange wurde das Gehirn links liegen gelassen, es bedarf mehr Hege und Pflege, sagt der Neurologe Raphael Wurm.
© Shutterstock
Worin unterscheiden sich das weibliche und das männliche Gehirn?“ – Die Frage sticht beim Surfen durchs Internet ins Auge. Der Artikel dazu ist kurz, nicht mehr taufrisch, weckt aber die Neugier: Wo stehen wir aktuell? Eine Universitätsprofessorin, die ich um ihre Meinung frage, mahnt zur Vorsicht: „Mir kommt eine solche Vergeschlechtlichung etwas seltsam vor.“
Die Recherche führt zu einem fesselnden und fundierten Beitrag, „Keine Geschlechtergerechtigkeit in der Demenz“ (via MedMedia.at), und zu einem der Autor*innen, zum Neurologen Raphael Wurm am Universitätsklinikum AKH Wien, der gleichsam auch Forscher an der Medizinischen Universität Wien ist. Ihn treffe ich zum Interview.
Ist die Frage überhaupt zulässig: Worin unterscheiden sich das weibliche und das männliche Gehirn?
Raphael Wurm: Sie zu stellen ist zulässig, denn wir sehen in vielen Bereichen der Medizin Unterschiede in der Häufigkeit mancher Krankheiten. Von Demenz sind etwa zwei Mal so viele Frauen betroffen wie Männer. Wie können wir also sicherstellen, dass wir die Unterschiede auch in Diagnose und Therapie berücksichtigen? Deswegen sind solche Fragen legitim.
Nicht einverstanden bin ich mit dem Zugang, wenn man herausfinden will, wie sich das weibliche und das männliche Gehirn unterscheiden, so wie sich etwa weibliche und männliche Straußenfedern unterscheiden. Es gibt Hunderte von Studien, die sich die Unterschiede vom Gehirn ansahen, nur ganz wenige verglichen aber beispielsweise das männliche und das weibliche Herz. Da ist also ein disproportionales Interesse da, weil manche vielleicht glauben, dass das Gehirn Unterschiede legitimieren kann, die wir auf einer gesellschaftlichen Ebene sehen. Davon würde ich Abstand nehmen. Es gibt in der Wissenschaft wenig Hinweise darauf, dass von Anfang an irgendetwas anders angelegt wäre.
Was wir hingegen wissen, ist, dass es der größte evolutionäre Vorteil des Menschen ist, sich an verschiedene und sich verändernde Umwelteinflüsse anzupassen und darin zu funktionieren. Ein sehr großer Umwelteinfluss ist unsere Gesellschaft: Wie die Gesellschaft auf Sie reagiert und wie Sie auf die Gesellschaft reagieren, prägt unser Gehirn sehr stark.
Sie suchen mit der Neurologin Elisabeth Stögmann Antworten darauf, weshalb mehr Frauen als Männer von Demenz betroffen sind. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?
Es ist eine noch immer nicht gänzlich geklärte Frage. Den größten Teil dieses Unterschieds macht aus, dass Frauen im Schnitt weltweit älter werden als Männer; das allein ist es aber nicht. Zu den Risikofaktoren gehört beispielsweise nicht genug Schutz des Gehirns im Sinne von positiver Verwendung über die Lebensspanne. Historisch betrachtet, unterscheiden sich hier die Geschlechter, weil Frauen lange der Zugang zu mehr Bildung verwehrt war und systematisch weniger Frauen „Gehirn brauchende“ Berufe ausüben konnten; das änderte sich – zumindest in den Industrienationen – in den letzten Jahrzehnten. In der gleichen Zeit haben Frauen im Zuge der Gleichstellung, die längst nicht abgeschlossen ist, in vielen Bereichen aufgeholt, was kardiovaskuläre Risikofaktoren angeht: etwa Alkohol und Rauchen.
Also auch hier: gesellschaftliche Faktoren – und die Suche geht weiter?
Ja, denn wir müssen uns auch die Diagnoseverfahren anschauen. In der Vergangenheit war es so: Wer ein Problem hatte, ging zur/zum Neurolog*in, es wurden Gedächtnistests gemacht, ein Bild vom Kopf, um bestimmte Dinge auszuschließen, die Diagnose wurde letztlich aufgrund eines Eindrucks gestellt. Erst langsam kommen wir bei Demenz und anderen neurologischen Erkrankungen dazu, dass sie messbar werden – im Nervenwasser oder im Blut. Dabei stellt man fest, dass es für den gleichen Schweregrad der Erkrankung Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Warum? – Weil die klassischen Gedächtnistests sprachlastig sind, Frauen aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen mehr soziale Kontakte haben und deshalb ihr verbales Gedächtnis und ihre verbale kognitive Leistungsfähigkeit besser zu sein scheinen. Vereinfacht gesagt: Sie testen besser. Bekommen sie also mit den scheinbar selben Testergebnissen das gleiche Medikament, greift es nicht mehr so gut, weil ihre Erkrankung da in Wahrheit schon weiter fortgeschritten ist. Gesellschaftlich normierte Testverfahren kreieren also einen Unterschied und damit letztlich das Problem.

Es gibt kaum Hinweise darauf, dass in unseren Gehirnen von Anfang an etwas unterschiedlich angelegt wäre.
Raphael Wurm, Neurologe und Forscheran der Medizinischen Universität Wien
Wie kommen wir da raus?
Wir haben uns lange mit dem Gendergap beschäftigt, er ist offensichtlich und es gibt hunderte Bereiche, wo man nachschärfen und investieren kann. In der Medizin wird es weiter in Richtung Personalisierung gehen; das biologische Geschlecht wird ein kleiner Punkt sein. Wir werden herausfinden, dass es Männer gibt, die jeder Frau ähnlicher sind als anderen Männern – und umgekehrt.
Sind unsere gewohnten zwei Schubladen also hinderlich?
Sie sind weder der Weisheit letzter Schluss noch sind sie immer sinnvoll. Wenn wir ein Medikament in zwei Klassen teilen oder Tests für Frauen und Männer machen, sind wir auf dem Holzweg. Wir sollten uns an messbaren Werten orientieren, die auf eine gewisse Art und Weise objektiv sind. Damit werden sich klassische Geschlechterunterschiede etwas auflösen und wir werden Zusammenhänge sehen, die möglicherweise weder mit dem biologischen noch mit dem gesellschaftlichen Geschlecht viel zu tun haben.
Was können wir präventiv für unser Gehirn tun?
Das Wichtigste: das Gehirn als eigenes schützenswertes Organ betrachten. Man macht Sport fürs Herz, geht zur Krebsvorsorge, das Gehirn wurde lange links liegen gelassen. Gehirngesundheit ist nicht nur die Abwesenheit einer Erkrankung, sondern das Gehirn so nutzen zu können, wie Sie wollen, um Ihre Ziele und ein Wohlbefinden zu erreichen.
Der wichtigste Parameter ist guter Schlaf. Zuletzt gab es diese Superman-Sleep-Typen und sonstige Lifehacker, die erzählt haben, sie schaffen es mit drei Stunden. Das ist sehr ungesund. Es gibt super Experimente, die zeigen, dass wenn sie Leuten eine Nacht Schlaf entziehen, sie ähnlich hohe Werte an Alzheimer-Proteinen haben wie Menschen mit Alzheimer-Demenz. Das Gehirn braucht den Schlaf als eine Art Reinigung, da wird aufgeräumt und konsolidiert. Das braucht eine gewisse Anzahl an Stunden Schlaf; das ist individuell: zwischen 6,5 und 8,5 Stunden.
Der zweite wichtige Parameter ist Training. Metaphorisch betrachtet kann man das Gehirn wie einen Muskel trainieren. Sind Menschen ein Leben lang sehr viel geistig aktiv, durch Arbeit oder Hobbys, haben sie mehr Energiereserven, wenn eine Krankheit kommt. Training passiert bei Aktivitäten, wo das Gehirn stimuliert wird: nicht von TV und Radio berieseln lassen, sondern bewusst folgen und lesen (siehe Artikel ab S. 40 im Magazin).
Drittens: Es gibt ein paar Dinge, die speziell schlecht sind für das Gehirn. Dazu gehört Schwerhörigkeit im mittleren Alter; wird eine Hörerkrankung behandelt, nimmt das zehn Prozent des Risikos für kognitive Erkrankungen. Ein weiterer großer Risikofaktor ist soziale Isolation, also Einsamkeit.
Was liegt Ihnen als Neurologe besonders auf dem Herzen?
Im Angehörigenkreis sind es zum überwiegenden Teil Frauen, die die Pflegearbeit übernehmen. Es ist wichtig, den Pflegenden anzubieten, Informationen und Unterstützung auch bei Selbsthilfe- und Angehörigengruppen einzuholen. Bei Demenz etwa ist im Verlauf der Erkrankung sehr viel Betreuung notwendig, häufig pflegen Frauen ihre Männer rund um die Uhr. Dabei kommt oft eine Verantwortung wie mit einem kleinen Kind. Nicht weil die Menschen infantil werden, sondern weil man aufpassen muss, dass der/die Patient*in beispielsweise nicht wegläuft. Es ist wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen, welche körperliche und psychische Belastung Pflege bedeutet. Das ist wesentlich mehr als jeder Vollzeitjob; diese Pflegeintensität ist ein Risikofaktor für Herzinfarkte, Schlaganfälle – und Demenzerkrankungen. Menschen, die lange pflegen, sterben früher. Wir dürfen pflegende Frauen nicht allein lassen, sie brauchen jedenfalls freie Tage und Urlaube.
Guter Schlaf braucht zeit
Während wir schlafen, erleben wir rund drei bis vier Mal die Abfolge von REM-Phase, leichter Schlaf und tiefer Schlaf. Die meiste Gehirngesundheit wird in der Tiefschlafphase umgesetzt, zwei bis drei Stunden sollten es laut dem Neurologen Raphael Wurm pro Nacht sein. Das kann man bei Problemen im Schlaflabor messen oder im Alltag mit einer Smartwatch. Glücklicherweise können wir Schlaf aufholen, beispielsweise am Wochenende. Das kompensiert aber nur zu einem gewissen Grad. „Das lässt sich nicht hacken; man kann nicht in drei Stunden Schlaf auf drei Stunden Tiefschlaf kommen“, betont Raphael Wurm. Bei einfachen Schlafproblemen helfen nachfolgende Tipps, bei schweren sollte man jedenfalls einen Ärztin aufsuchen.
- Vor dem Einschlafen: keine Geräte, zumindest nichts mit Licht (kein Handy, kein Tablet etc.)
- Das Bett nur zum Schlafen verwenden: dort sollte weder gegessen noch ferngesehen werden.
- Den Raum kühl und dunkel halten. Nachtdienste sind bekanntlich nicht gesundheitsfördernd, aber in vielen Berufen unvermeidbar. Um Schlaf nachzuholen, hilft es, auch tagsüber zu verdunkeln oder eine Schlafbrille zu verwenden.
- Unterbrechungen minimieren: Das wird zumeist mit dem Alter schwieriger; um nächtliche Toilettengänge zu reduzieren, kann es helfen, eine Stunde vor dem Schlafengehen nichts mehr zu trinken.
- Kein Alkohol (höchstens in geringer Menge): Alkohol wirkt neurophysiologisch im Gehirn auf die gleichen Rezeptoren wie manche Beruhigungsmittel; man schwankt quasi zwischen verschiedenen Phasen, es gelingen keine normalen erholsamen Tiefschlafphasen.
DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN:
• Gedächtsnistrainig – das ist MERKwürdig!